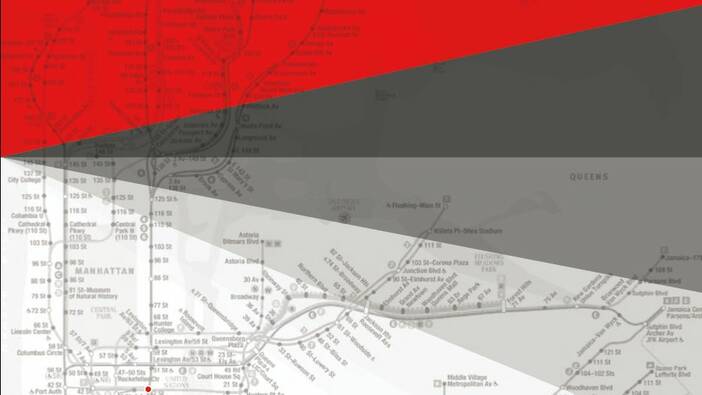Das Gesetz, das US-Präsident Lyndon B. Johnson am 2. Juli 1964 unterzeichnete, war nicht das erste und nicht das letzte Bürgerrechtsgesetz in der Geschichte der USA, aber sicherlich das wichtigste. Nicht nur für die afro-amerikanische Bevölkerung und die Bürgerrechtsbewegung war der Civil Rights Act von 1964 ein Meilenstein, weil er die im Süden des Landes übliche Segregation beendete. Vielmehr ist er auch für zahlreiche weitere gesellschaftliche Gruppen von umfassender Bedeutung gewesen, kodifizierte das Gesetz doch ein Verbot der Diskriminierung auf der Basis von «race», Hautfarbe, Religion, Geschlecht und nationaler Herkunft. Zahlreiche Gesetze folgten später, um auf der Basis des Civil Rights Acts unter anderem auch Schwangere und Behinderte vor systematischen Benachteiligungen durch den Staat und Arbeitgeber zu schützen. Allerdings musste die Durchsetzungsmacht der Bundesregierung in der Folge noch mehrfach gestärkt werden. Insbesondere das Wahlrecht der Afro-AmerikanerInnen musste durch den ein Jahr später folgenden Voting Rights Act noch spezifischer geschützt werden als es der Civil Rights Act vorsah. Denn die Staaten des «Deep South», die im Bürgerkrieg für die Erhaltung der Sklaverei gekämpft hatten und danach fast einhundert Jahre ein elaboriertes System der Segregation zwischen Weißen und Schwarzen errichtet hatten, nutzten weiterhin alle Möglichkeiten, die ihnen der Civil Rights Act noch gelassen hatte, Afro-AmerikanerInnen von der Wahlurne fernzuhalten. Beispielsweise wurden Lesetests erst durch den Voting Rights Act explizit verboten.
Der Widerstand der Demokraten aus den Südstaaten
Johnson hatte das umfassendste Bürgerrechtsgesetz in der Geschichte der USA unter Aufbietung aller Kräfte und Tricks durch beide Häuser des US-Kongresses bringen müssen. Der Widerstand von Rassisten beider Parteien, vor allem aber von Südstaatendemokraten, war heftig. Sie organisierten im Senat einen sogenannten Filibuster. 72 Tage lang blockierten sie den Gesetzgebungsprozesses durch Dauerreden. Doch ihnen blies seit einem Jahrzehnt der Wind des Wandels ins Gesicht. Der Oberste Gerichtshof hatte 1954 im Fall «Brown vs. Board of Education» seine frühere Bewertung der Rassentrennung – «separate but equal» («getrennt, aber gleich», Plessy vs. Ferguson, Entscheidung von 1896) – aufgehoben und geurteilt, dass Rassentrennung «inherently unequal» («grundsätzlich ungleich») sei. Dwight D. Eisenhower, Republikaner und Präsident von 1952 bis 1960, hatte die Nationalgarde eingesetzt, um afroamerikanischen Schülern und Studenten Zutritt zu bis dahin Weißen vorbehaltenen Bildungseinrichtungen zu ermöglichen. John F. Kennedy, Johnsons im November 1963 ermordeter Vorgänger, hatte nach langem Zögern endlich die Demokratische Partei zur Unterstützung der Forderungen der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung bewegt, die unter der Führung von Martin Luther King Jr., und vielen anderen zeigte, wie man mit gewaltlosem zivilem Widerstand ein perfides Unrechtsregime bloßstellt.
Dr. Thomas Grevenist Privatdozent für Politikwissenschaft am John F. Kennedy-Institut für Nordamerikastudien der Freien Universität Berlin.
Denn darin lag für Kennedy und andere in der Demokratischen Partei mutmaßlich ein zentrales Motiv, sich die Forderungen der Bürgerrechtsbewegung zu eigen zu machen. Sie waren um das Ansehen der USA im Kalten Krieg besorgt, war doch der offensichtliche Widerspruch zwischen der behaupteten Führerschaft im Kampf für Menschenrechte und Demokratie und den Fernsehbildern von auf friedliche Demonstranten gehetzten Hunden für alle Menschen, auch im umkämpften Globalen Süden, klar zu sehen. Muhammad Ali, als Boxer ein Weltstar, brachte es bei seiner Kriegsdienstverweigerung 1967 auf den Punkt: «No VietCong ever called me N…r», kein Vietcong hat mich je N…r genannt.
Der Wandel der Demokraten war längst überfällig. Bei den Präsidentschaftswahlen 1860 hatte ihre Spaltung zwischen Nord- und Süddemokraten dem Republikaner und Gegner der Sklaverei Abraham Lincoln den Sieg ermöglicht. Nach dem verlorenen Bürgerkrieg vereinten sich die Demokraten schließlich wieder, blieben aber eine Partei mit zwei Gesichtern, wenn es um die Frage der Segregation ging. Im Süden waren die Demokraten deren entschlossene Verteidiger und dominierten deshalb die ehemaligen Staaten der abtrünnigen Konföderation, den «solid South», für über einhundert Jahre völlig. Als die Demokraten im Zuge der Bekämpfung der «great depression», also der Weltwirtschaftskrise, unter Franklin D. Roosevelt zur Partei eines aktiven modernen Sozialstaats wurden, brauchten sie für ihre «New Deal» genannten Wirtschafts- und Sozialprogramme die Stimmen der Demokraten aus den Südstaaten. Diese wussten mit ihrem politischen Pfund zu wuchern und sicherten sich die weitere Toleranz für die Praxis der Rassentrennung und auch die Aufrechterhaltung ihres traditionellen oligarchischen Wirtschafts- und Staatsmodells: So wurden Landarbeiter und Hausangestellte vom neuen Arbeits- und Gewerkschaftsrecht ausgenommen – nicht zufällig Jobs, die vielfach von AfroamerikanerInnen ausgeübt wurden. Bis heute wirkt in den ehemaligen Staaten der Konföderation nach, dass der New Deal dort nur unvollständig durchgesetzt wurde. So ist es die Schwäche der Gewerkschaften im Süden der USA, die auch deutsche und japanische Automobilhersteller dorthin gezogen hat. Niedrige Steuern, schwacher (Sozial-)Staat – «low tax, low service» – das könnte bis heute das offizielle Motto des ganzen amerikanischen Südens sein. Johnson nutzte geschickt die Ermordung Kennedys 1963, um den Civil Rights Act durch den US-Kongress zu bringen: Mit dem Bürgerrechtsgesetz würden die Demokraten dessen Erbe würdigen. Damit hatte er schließlich Erfolg. Zugleich aber wusste oder ahnte er zumindest, dass die Demokraten einen politischen Preis für die umfassende Bürgerrechtsgesetzgebung zahlen würden. Die Segregation und die Diskriminierung der AfroamerikanerInnen im amerikanischen Süden effektiv durch die Bundesregierung zu beenden, würde bedeuten «den Süden für eine Generation zu verlieren» – so oder so ähnlich formulierte es Johnson der Legende nach, als er seine Unterschrift unter den Civil Rights Act setzte.
Die Folgen für das Parteiensystem
Und tatsächlich ist die völlige Veränderung der parteipolitischen Landschaft der USA das nachhaltigste Erbe des Civil Rights Acts und der folgenden Bürgerrechtsgesetzgebung, neben den erheblichen Fortschritten nicht nur für AfroamerikanerInnen, sondern für alle Bevölkerungsgruppen, die unter Diskriminierung leiden. Denn die Republikaner, die Partei Lincolns und der Sklavenbefreiung, waren zum Zwecke des Machterwerbs ihrerseits zu einem opportunistischen Wandel bereit. Sie sahen nämlich die Gelegenheit, die von den nun bürgerrechtsfreundlichen Demokraten enttäuschten Wähler im amerikanischen Süden für sich zu gewinnen. Mit der «Southern Strategy» gewann Richard Nixon 1968 die Präsidentschaft, später weitete Ronald Reagan die Strategie auf die weißen Vorstädte aus: Wem die Beteiligung von Afroamerikanern an der Politik, an der Wirtschaft, an den Leistungen des Sozialstaats, an höherer Bildung, an besseren Arbeitsplätzen, und ihre Präsenz in besseren, sprich weißen Wohngegenden zu weit ging, der fand nun in der zunehmend weißen Republikanischen Partei eine politische Heimat.
Diese Neuordnung der amerikanischen Parteipolitik – «realignment» genannt – als Erbe des Civil Rights Acts wirkt bis heute fort: Es war und ist vor allem die Angst vor einer «majority-minority-society» – einer Gesellschaft, in der durch demographischen Wandel die Summe der Minderheiten größer sein wird als die Bevölkerungsgruppe der Weißen – die den Aufstieg von Donald Trump erklärt. Die Basis der Republikaner hat sich während der Präsidentschaft Barack Obamas radikalisiert – vor allem durch die Tea Party-Bewegung– und Trump bot sich geschickt als Führer des Aufstands an, als «letzte weiße Hoffnung», auch gegen das eigene, zu kompromissbereite Parteiestablishment. Und tatsächlich hat der Backlash gegen die Fortschritte der Bürgerrechtsbewegung längst begonnen. Dabei haben juristische Neubewertungen des Civil Rights Acts und des Voting Rights Acts den politischen Rückwärtsbewegungen Tür und Tor geöffnet. Schon 2001 befand der Oberste Gerichtshof der USA im Urteil «Alexander vs. Sandoval», dass Privatpersonen bei bestimmten Verstößen gegen das Diskriminierungsverbot des Civil Rights Acts nicht klageberechtigt seien. Das sogenannte Standing ist im amerikanischen Rechtssystem von höchster Bedeutung – Gerichte können sachlich begründete Klagen abweisen, wenn sie feststellen, dass keine Klageberechtigung vorliegt. Angesichts der chronischen Überforderung staatlicher Stellen – die weiterhin klageberechtigt sind – war die Entscheidung des Supreme Court faktisch eine Einladung zu Rechtsverstößen. Noch deutlicher hat das Gericht politische Maßnahmen gegen den Geist des Voting Rights Act ermöglicht – wir erinnern uns: dieses Gesetz war auch deshalb notwendig, weil in den Südstaaten auch nach der Verabschiedung des Civil Rights Acts das Wahlrecht von Afroamerikanern weiter beschränkt wurde. In der Entscheidung «Shelby County vs. Holder» stellte das Gericht 2013 Teile des Gesetzes außer Vollzug, weil ihre Ziele erreicht seien. So müssen Staaten der ehemaligen Konföderation seitdem nicht länger die Genehmigung des Bundesjustizministeriums einholen, wenn sie ihr Wahlrecht abändern. Sofort nach dem Urteil begannen Staaten, die von Republikanern regiert werden, damit, restriktive gesetzliche und administrative Maßnahmen umzusetzen, die nach allgemeiner Einschätzung gezielt die Wahlbeteiligung von Minderheiten und jungen Amerikanern einschränken sollen. Da in den USA auch die Wahlen für bundesweite Ämter von den einzelnen Staaten administriert werden, hat dies Konsequenzen für die Präsidentschafts- und Kongresswahlen.
Diese gezielten Maßnahmen zur Unterdrückung der Wahlbeteiligung von Minderheiten und jungen Amerikanern gründen auf der Annahme, dass diese mehrheitlich die Demokraten wählen. Tatsächlich aber haben unter anderem Donald Trump und in Florida Ron DeSantisinzwischen erstaunliche Erfolge bei afroamerikanischen und latinoamerikanischen Wählern vorzuweisen – insbesondere bei Männern. Ironischerweise haben auch diese Erfolge indirekt mit dem Civil Rights Act zu tun. Die bürgerrechtlichen Maßnahmen gegen Diskriminierung haben nämlich auch der Frauenbewegung geholfen, mehr Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern zu erreichen. Auch die Situation für die LGBTQ+ Communities hat sich durch die Bürgerrechtsgesetzgebung verbessert – beispielsweise wäre die Durchsetzung der gleichgeschlechtlichen Ehe ohne die Fortschritte durch den Civil Rights Act kaum denkbar. Nur gibt es inzwischen eben auch wieder eine äußerst motivierte Gegenbewegung, weil nicht nur die Weißen um ihre politische, wirtschaftliche und kulturelle Vorherrschaft fürchten, sondern auch die Christen. Unter dem Stichwort «Christian Nationalism» kämpfen verschiedene reaktionäre Kräfte für eine Rückkehr zu traditionellen, männerdominierten Gesellschafts- und Familienbildern. Darunter befinden sich auch afroamerikanische und latinoamerikanische Gruppen und Akteure.
Nicht nur aufgrund dieser Entwicklungen haben die USA das zwischenzeitlich durch den Civil Rights Act und andere Bürgerrechtsgesetze erlangte Ansehen in der Welt inzwischen längst wieder verspielt. Die südafrikanische Anti-Apartheid-Bewegung und andere AktivistInnen überall auf der Welt konnten sich noch positiv auf die Fortschritte in den USA beziehen. Aber spätestens seit der völkerrechtswidrigen Irak-Invasion 2003 und den Horrorbildern aus Gefängnissen wie Abu Ghraib ist kein Leuchtfeuer mehr zu sehen. Nun wankt unter dem Eindruck eines Möchtegernautokraten wie Trump auch die amerikanische Demokratie selbst. Das Recht auf Waffenbesitz scheint besser geschützt zu sein als die zivilen Bürgerrechte. Das Ausmaß der Polizeibrutalität gegenüber Minderheiten ist beängstigend. Die Bereitschaft zur politischen Gewalt steigt, insbesondere bei Republikanern. Am 60. Jahrestag der Unterzeichnung des Civil Rights Act steht fest: Die USA benötigt dringend eine neue Initiative zur nachhaltigen Sicherung der Rechte aller ihrer BürgerInnen.
Zum Weiterlesen
- Manfred Berg: Das gespaltene Haus. Eine Geschichte der Vereinigten Staaten von 1950 bis heute. Klett-Cotta, Stuttgart, 2024.
- Robert D. Loevy: To End All Segregation. The Politics of the Passage of The Civil Rights Act of 1964, Lanham, MD: University Press of America, 1990.