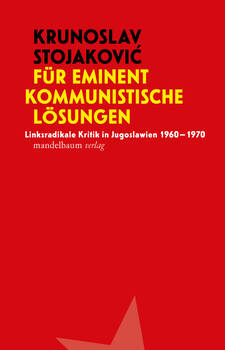
Der Blick auf das frühere Jugoslawien ist in Deutschland oft merkwürdig verengt – verbreitet ist die Ansicht, nur die Autorität Titos habe diesen Bundesstaat zusammengehalten, und nach seinem Tod hätten sich zwangsläufig wieder die nationalistischen Strömungen durchgesetzt. Dabei wird überhaupt nicht mehr danach gefragt, ob die Entwicklung Jugoslawiens von Kämpfen um den politischen Kurs geprägt war, welche Alternativen es an entscheidenden Punkten gab etc.
Um diese Lücke zu schließen, ist nicht zuletzt eine Beschäftigung mit der jugoslawischen 68er-Protestbewegung angezeigt, die das titoistische System mit Kritik von links konfrontierte und ihre Aufgabe in der Kritik aller Verhältnisse der Über- und Unterordnung sah – insofern war sie linksradikal. Nachdem Boris Kanzleiter2011 seine Dissertation »Die rote Universität « mit einem Schwerpunkt auf der Belgrader Studierendenbewegung veröffentlicht hat, ist nun die Dissertation von Krunoslav Stojakovićerschienen, deren Fokus auf den Debatten in der jugoslawischen Philosophie-, Film- und Theaterszene der 1960er Jahre liegt. Stojaković will herausfinden, wie sich gemeinsame Deutungsmuster herausgebildet hatten, die zur Mobilisierung sozialer Bewegungen erforderlich sind.
Dr. Heiko Bolldorf, geb.1980. Promotion zum Thema «Die soziale Macht der Gewerkschaften in Kroatien». Forschungsschwerpunkt: Politik und Gesellschaft der Nachfolgestaaten Jugoslawiens, tätig als freiberuflicher Referent in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit.
Konflikte einer linksradikalen Strömung mit der herrschenden Parteilinie zeichneten sich schon in den 1930er Jahren ab, als Schriftsteller wie Miroslav Krleža gegen die Unterordnung der Kunst unter die Linie der Partei protestierten. Nach dem Bruch mit Stalin erwartete die jugoslawische KP von den jugoslawischen Philosophen eine Legitimation ihrer Eigenständigkeit; in diesem Klima war die Entstehung unorthodoxer Strömungen wie der Zeitschrift «Praxis»möglich, deren humanistische Marx- Lesart für die 68er-Bewegung eine wichtige Rolle spielte. Die Praxis-Philosophinnen und -philosophen sahen ihre Aufgabe mit Marx in der «Kritik alles Bestehenden», einschließlich der unzulänglichen Realisierung der proklamierten Arbeiterselbstverwaltung in Jugoslawien. Selbst das bisher unangetastete ideologische Monopol des Bundes der Kommunisten wurde hinterfragt – dem BdKJ wurde vorgeworfen, ihm fehle die Fähigkeit zur Selbstkritik, und daher sei er keine echte Avantgarde.
Experimentelle Bewegungen in verschiedenen künstlerischen Bereichen bezogen sich oft auf die Praxis- Philosophie. Im Neuen Jugoslawischen Film, von der Parteipresse auch als «Schwarze Welle» bezeichnet, wurden statt der strahlenden Heldinnen und Helden des Partisanenfilms Alltagsprobleme und unglückliche Persönlichkeiten gezeigt. In der alternativen Theaterszene wurde Brecht stark rezipiert – mit seinem «epischen Theater» wurde die Hoffnung verknüpft, die Zuschauerinnen und Zuschauer zum aktiven Eingreifen in die gesellschaftlichen Strukturen bewegen zu können.
Die Verbindung zwischen Theater und Gesellschaftskritik wurde während der Belgrader Universitätsbesetzung im Sommer 1968 deutlich, deren Voraussetzungen und Verlauf Stojaković nachzeichnet. Auf seiner siebten Jahreskonferenz 1966 erklärte der jugoslawische Studentenbund, eine über studentische Interessen hinausgehende, aktive gesellschaftspolitische Rolle einnehmen zu wollen, die auch die Kritik an bürokratischen Deformationen des Sozialismus einschließen sollte – ebenso wie an Kürzungen im Bildungsbereich im Zuge des Ausbaues von Marktbeziehungen in den 1960er Jahren. Seit Ende 1966 gab es dann Proteste gegen den Vietnamkrieg, die nicht mehr unter der Kontrolle der Partei standen. Im Juni 1968 folgte die Besetzung der Philosophischen Fakultät in Belgrad, die weitere Universitätsbesetzungen in ganz Jugoslawien auslöste. Viele prominente Künstlerinnen und Künstler solidarisierten sich mit der Bewegung und lobten ihr über universitäre Forderungen hinausgehendes Engagement.
Stojaković weist darauf hin, dass sich das «kognitive Grundgerüst» der Bewegung schon lange vor den Universitätsbesetzungen geformt hatte: es war «linksradikal» im Sinne der Ablehnung einer auf Herrschaftsverhältnissen basierenden Gesellschaft. Ohne die Praxis-Philosophie und die avantgardistischen Bewegungen auf den Gebieten von Film und Theater wäre diese Bewegung so nicht denkbar gewesen.
Das Buch ist allen, die an der Aufarbeitung des jugoslawischen Modells interessiert sind, sehr zur Lektüre zu empfehlen. Es schließt eine wichtige Forschungslücke, denn jugoslawische Kunst und Kultur sind in Deutschland kaum bekannt. Es begründet seine Kernthese überzeugend, denn es werden nicht nur Analogien zwischen Stellungnahmen der Studierendenbewegung und Diskussionen der künstlerischen Avantgarde gezeigt, sondern es wird außerdem auf personelle Verflechtungen hingewiesen – während der Besetzung in Belgrad wurde der Innenhof der philosophischen Fakultät zur Bühne für Philosophinnen und Philosophen sowie für Künstlerinnen und Künstler. Wichtige Regisseure des Neuen Jugoslawischen Films nahmen aktiv an der Bewegung teil – während es dem Staat auf der anderen Seite gelang, die Bewegung und die Arbeiterklasse voneinander zu isolieren. So scheiterte die Bewegung mit ihrer radikalen Kritik, und Jugoslawien wurde nicht demokratisiert, sondern lediglich immer weiter dezentralisiert, was nationalistischen Strömungen Auftrieb gab.
Uns bleibt nach der Lektüre dieses Buches die Aufgabe, die Diskussion fortzusetzen, was Emanzipation von der kapitalistischen Produktionsweise heißen kann. Die jugoslawische Erfahrung zeigt, dass auch eine «Arbeiterselbstverwaltung» im Rahmen einer bürokratischen Parteidiktatur auf der einen und von Warenproduktion und Markt auf der anderen Seite keine Lösung ist. Eine neuerliche Beschäftigung etwa mit den Schriften der Praxis-Gruppe kann hier sicher wertvolle Anregungen liefern.
Krunoslav Stojaković: Für eminent kommunistische Lösungen. Linksradikale Kritik in Jugoslawien 1960 – 1970, Mandelbaum-Verlag, Wien 2022, 404 Seiten, 30 Euro
Diese Rezension erschien zuerst in Z. Zeitschrift Marxistische Erneuerung, Heft 138.
